Virtual Reality in der Pflegeausbildung: Chancen, Praxisbeispiele und Erkenntnisse
Virtual Reality (VR) hält zunehmend Einzug in die berufliche Bildung – auch in der Pflegeausbildung. Der Einsatz immersiver Technologien ermöglicht realitätsnahe Übungssituationen, in denen angehende Pflegekräfte unter sicheren Bedingungen Erfahrungen sammeln, Fehler machen und daraus lernen können. Besonders dort, wo reale Trainingsbedingungen nur schwer herzustellen sind – etwa im Umgang mit demenziell Erkrankten oder bei komplexen Kommunikationssituationen – eröffnet VR neue didaktische Perspektiven.
Dieser Beitrag zeigt anhand eines konkreten Beispiels der Bamberger Akademien, wie VR sinnvoll in die Pflegeausbildung integriert werden kann. Dabei geht es um mehr als nur Technik: Im Mittelpunkt stehen die pädagogische Einbettung, die konkrete Umsetzung im Unterricht und die Erfahrungen von Lernenden mit dieser innovativen Methode.
Hintergrund: Die Bamberger Akademien und der Referent
Die Bamberger Akademien für Gesundheitsberufe zählen zu den etablierten Bildungseinrichtungen in Bayern, wenn es um die Ausbildung im Gesundheits- und Pflegebereich geht. Über 550 Auszubildende werden dort aktuell in verschiedenen Berufsgruppen ausgebildet – darunter:
- Pflegefachfrau/-mann
- Pflegefachhelfer\:in
- Physiotherapeut\:innen
- Operationstechnische Assistent\:innen (OTA)
- Anästhesietechnische Assistent\:innen (ATA)
Zusätzlich gibt es Kooperationen mit Hochschulen, zum Beispiel mit der Hochschule Coburg im Bereich Hebammenwissenschaft. Die Akademie bietet darüber hinaus ein breites Spektrum an Fort- und Weiterbildungen sowie pflegebezogenen Studienangeboten.
Frank Feick, der Referent auf unserer Veranstaltung war, istMedizinpädagoge (M.A.), Certified Nursing Educator und Leiter des Bereichs SimBaLL – Simulationsbasiertes Lehren und Lernen – an den Bamberger Akademien.
Sein Ansatz verbindet praktische Erfahrung aus der Pflege mit pädagogischer Innovationsfreude. Er fragt nicht nur, was man lehren soll, sondern vor allem, wie man es wirkungsvoll vermitteln kann. Virtual Reality ist für ihn dabei kein technisches Spielzeug, sondern ein Werkzeug, um Lernsituationen realistischer, sicherer und nachhaltiger zu gestalten.
Mit diesem Hintergrund entwickelt Feick didaktische Konzepte, in denen moderne Technologien wie VR gezielt in die Pflegeausbildung integriert werden – immer mit dem Blick auf das, was Auszubildende in der Praxis wirklich weiterbringt.
Pädagogisches Konzept: Simulationsbasiertes Lernen
Pflegeausbildung findet heute an verschiedenen Lernorten statt – von der klassischen Theorie im Unterricht bis hin zu praktischen Einsätzen in der Klinik. Dazwischen liegt ein breites Feld an Trainingsformaten, das zunehmend durch simulationsbasiertes Lernen ergänzt wird. Virtual Reality (VR) spielt dabei eine immer wichtigere Rolle.
An den Bamberger Akademien wird VR nicht als Ersatz, sondern als Erweiterung bestehender Methoden verstanden. Die Lernprozesse gliedern sich dabei in folgende Bausteine:
- Theorievermittlung im Unterricht
- Skills-Training zur Übung konkreter Handgriffe
- Simulationen mit echten Personen oder Puppen
- Virtuelle Szenarien in VR, die komplexe Situationen abbilden
Ziel ist es, eine fehlerfreundliche, realitätsnahe und ethisch sichere Lernumgebung zu schaffen. Auszubildende können hier mit Patient\:innen-Avataren interagieren, Entscheidungen treffen und Kommunikationsstrategien ausprobieren – ohne reale Risiken für echte Menschen. Fehler sind erlaubt, sogar gewünscht – denn gerade daran lernen sie.
Durch die gezielte Kombination aus Theorie, Praxis und virtuellen Simulationen entsteht ein didaktisches Gesamtkonzept, das Auszubildende systematisch auf den beruflichen Alltag vorbereitet. VR wird dabei als Werkzeug genutzt, um kritische Situationen erfahrbar zu machen, die im echten Klinikalltag selten oder schwer zu üben sind.
Einsatz von VR in der Ausbildung
Der Einsatz von Virtual Reality in der Pflegeausbildung an den Bamberger Akademien folgt einem klar strukturierten technischen und didaktischen Rahmen. Ziel ist es, Lerninhalte nicht nur modern, sondern auch pädagogisch fundiert zu vermitteln.
Nutzung bestehender VR-Szenarien
Zum Einsatz kommen VR-Szenarien des Anbieters SimX, die gezielt für den Gesundheitsbereich entwickelt wurden. Diese Szenarien bilden typische Situationen aus dem Pflegealltag ab – etwa in der ambulanten Versorgung, in Kliniken oder bei psychiatrischen Fragestellungen. Die Lernenden bewegen sich in virtuellen Umgebungen, interagieren mit Patient\:innen-Avataren und führen assessmentspezifische Aufgaben durch – etwa zur Atemüberwachung, Schmerzbewertung oder Sturzprophylaxe.
Didaktische Anpassung an Lernende
Die Szenarien werden didaktisch angepasst – je nach Sprach- und Handlungskompetenz der Auszubildenden. So lassen sich zum Beispiel auch Szenarien gestalten, die gezielt auf Lernende mit Migrationshintergrund oder unterschiedliche Ausbildungsstände eingehen. Der VR-Einsatz ist dabei kein standardisiertes „one size fits all“-Modell, sondern wird bewusst differenziert eingesetzt.
Unterstützung bei Anerkennung und Weiterbildung
Ein weiterer Vorteil: VR-gestützte Szenarien unterstützen Pflegekräfte aus dem Ausland beim Anerkennungsverfahren. Sie helfen, Unterschiede zwischen Ausbildungs- und Versorgungssystemen zu überbrücken und machen spezifische Handlungssituationen in Deutschland erfahrbar. Auch in der beruflichen Weiterbildung – etwa im Bereich Kommunikation oder Deeskalation – kommt VR gezielt zum Einsatz.
Insgesamt zeigt sich: Der Mehrwert von Virtual Reality liegt nicht in der Technik allein, sondern in der pädagogischen Einbettung – angepasst an Zielgruppe, Lernziel und Praxisanforderung.
Praxisbeispiele aus dem Unterricht
Wie Virtual Reality konkret in der Pflegeausbildung angewendet wird, zeigen drei ausgewählte Szenarien aus dem Unterricht der Bamberger Akademien. Sie decken unterschiedliche Versorgungssituationen ab – von der ambulanten Pflege bis hin zu komplexen kommunikativen Herausforderungen im klinischen Alltag.
Beispiel 1: Ambulante Pflege – COPD-Patient Wallace Peterson
In diesem Szenario betreuen die Lernenden den Patienten Wallace Peterson, der an COPD und Diabetes Typ 2 leidet. Die virtuelle Umgebung zeigt eine häusliche Wohnung, in der die Auszubildenden folgende Aufgaben umsetzen:
- Durchführung eines Assessments (Atmung, O₂-Sättigung)
- Nutzung von Hilfsmitteln wie Pulsoximeter oder Sauerstoffflasche
- Situationsangepasste Kommunikation und Beratung, z. B. zum Rauchverhalten oder zur Atemtechnik (Lippenbremse)
Besonderheit: Die Lernenden müssen auch auf Umgebungsreize (z. B. lautes Radio) und die Interaktion mit Angehörigen reagieren – eine realitätsnahe Übung für den Alltag in der ambulanten Versorgung.
Beispiel 2: Klinikalltag – Patientin Lisa Rae nach Sturz
In einem weiteren Szenario treffen die Auszubildenden auf Lisa Rae, die nach einem Sturz mit Hypotonie und Inkontinenz in die Klinik eingeliefert wurde. Ziel dieses Settings ist es, die klinische Beobachtung und Prävention zu trainieren:
- Assessment zu Schmerz, Hautzustand, Sturzgefahr
- Umsetzung von präventiven Maßnahmen wie Rufsystemen oder Lagerungshilfen
- Empathische Kommunikation, da die Patientin unzufrieden ist, ihre Selbstständigkeit verloren zu haben
Hier lernen die Auszubildenden, klinische Standards mit situativer Gesprächsführung zu verbinden – ein wichtiges Element der professionellen Pflegepraxis.
Beispiel 3: Umgang mit Demenz – Herr Ri Liang
Das dritte Szenario widmet sich einem besonders sensiblen Thema: dem Umgang mit demenziell erkrankten Menschen. Der virtuelle Patient Herr Ri Liang ist 68 Jahre alt und zeigt deutliche Zeichen von Desorientierung und Kommunikationsproblemen. Die Familie ist mit der häuslichen Pflege zunehmend überfordert.
Die Aufgaben der Lernenden:
- Anwendung von Kommunikations- und Deeskalationsmodellen
- Gesprächsführung mit Angehörigen, insbesondere dem Sohn
- Erkennen und angemessenes Reagieren auf kritische Situationen
Dieses Szenario bietet die Möglichkeit, theoretisch erlernte Konzepte wie Validation oder personenzentrierte Kommunikation in einem geschützten Raum zu erproben – mit unmittelbarem Feedback durch die virtuelle Reaktion des Avatars.
Alle drei Beispiele zeigen: VR ermöglicht es, komplexe Pflegesituationen erfahrbar zu machen, ohne reale Risiken einzugehen – und genau darin liegt ihr pädagogischer Wert.
Evaluation und Ergebnisse
Um den tatsächlichen Mehrwert von Virtual Reality in der Pflegeausbildung zu messen, wurde an den Bamberger Akademien eine Befragung unter 49 Auszubildenden durchgeführt. Die Teilnehmenden befanden sich im zweiten Ausbildungsjahr und testeten VR-Szenarien im Rahmen der psychiatrischen Versorgung.
Die Ergebnisse sind eindeutig:
- 48 von 49 Auszubildenden bewerteten VR als sinnvolle Ergänzung zur klassischen Ausbildung.
- Besonders positiv hervorgehoben wurde der Transfer von theoretischem Wissen in die praktische Anwendung innerhalb der virtuellen Szenarien.
- Auch die Lernmotivation stieg durch die interaktive und immersive Gestaltung merklich.
Trotz der hohen Akzeptanz wurden auch Herausforderungen deutlich:
- Motion Sickness kann bei sensiblen Personen auftreten, insbesondere bei längeren Anwendungen.
- Technische Latenzen oder fehlende Passung zwischen VR-Umgebung und realer Pflegesituation erschweren gelegentlich den Lernfluss.
- Eine didaktisch strukturierte Einführung ist notwendig – VR funktioniert nicht „out of the box“, sondern muss pädagogisch eingebettet werden.
Didaktische Einordnung
Der Einsatz von Virtual Reality wird an den Bamberger Akademien nicht als technischer Selbstzweck verstanden, sondern konsequent didaktisch eingebettet. Eine zentrale Orientierung bietet dabei Millers Pyramide der klinischen Kompetenz:
- „Knows“: Theoretisches Wissen erwerben
- „Knows how“: Verständnis für Abläufe entwickeln
- „Shows“: Anwendung in einer kontrollierten Umgebung zeigen
- „Does“: Handlungskompetenz im realen Setting beweisen
VR ermöglicht es, diese Stufen schrittweise, realitätsnah und risikolos zu durchlaufen – insbesondere im Bereich „Shows“ und „Does“. Lernende erleben komplexe Situationen, treffen Entscheidungen und reflektieren ihr Handeln im Debriefing.
Auch die wissenschaftliche Studienlage spricht für den Einsatz von VR in der Pflegebildung:
- Höhere Lernmotivation durch interaktive Szenarien
- Reduktion von Fehlern in der realen Praxis
- Individualisiertes Lernen im eigenen Tempo
- Bessere Visualisierung abstrakter Inhalte
Damit bietet VR nicht nur ein modernes Lernformat, sondern stärkt gezielt die Handlungskompetenz – das zentrale Ziel jeder Pflegeausbildung.
Fazit und Ausblick
Virtual Reality ist in der Pflegeausbildung kein Ersatz für bewährte Lernmethoden, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Sie ermöglicht das sichere Üben komplexer Situationen, in denen Fehler erlaubt und sogar erwünscht sind. Besonders bei kommunikativen Herausforderungen, ethisch sensiblen Szenarien oder schwer simulierbaren Fällen zeigt sich der Mehrwert virtueller Lernumgebungen deutlich.
Gleichzeitig gilt: Der Einsatz von VR entfaltet sein Potenzial nicht automatisch. Entscheidend sind eine sorgfältige didaktische Einbettung, eine technisch stabile Umsetzung und eine pädagogische Begleitung – etwa durch Briefing, Debriefing und reflektierende Auswertung der Erfahrungen.
Für die Zukunft bedeutet das: Virtual Reality kann die Pflegeausbildung bereichern – wenn sie gezielt, durchdacht und lernzielorientiert eingesetzt wird. Die bisherigen Erfahrungen an den Bamberger Akademien zeigen, dass dies gelingen kann.
Download
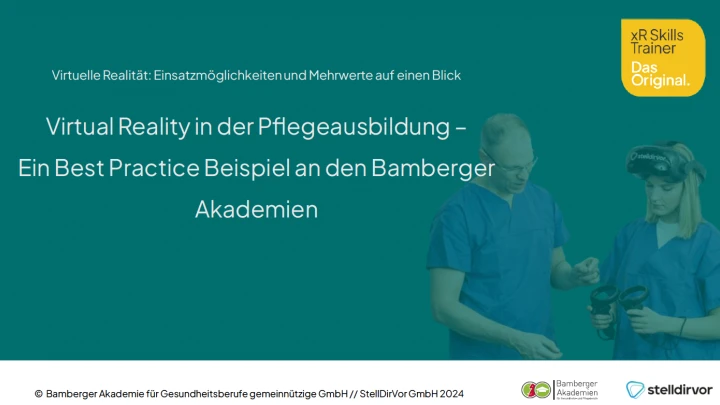
Virtual Reality in der Pflegeausbildung
Präsentation Vortrag Frank Feick, Bamberger Akademien für Gesundheitsberufe.
Veranstaltung

Virtuelle Realität: Einsatzmöglichkeiten und Mehrwerte auf einen Blick
30.04.2025
Erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Einsatzmöglichkeiten der VR-Brille im Gesundheitswesen.
